Auch schon über den Begriff „Schrebergarten“ gestolpert? Woher er kommt und was es damit auf sich hat – alle Details dazu hier!
Sie sind begehrte Rückzugsorte, Plätze des Schaffens, Erntens und Erholens. Vor allem dort, wo es an Grünflächen mangelt, sind Schrebergärten beliebt. In Großstädten existieren lange Wartelisten, und besonders Familien mit Kindern sind froh, eine Parzelle erobert zu haben. Deutschlandweit existieren über eine Million Schrebergärten, welche eine Fläche von mehr als 46.000 Hektar Land einnehmen. Schrebergärten sind Teil einer Kleingartenanlage und sind maximal 400 Quadratmeter groß. Im Folgenden wird verraten, wie der Schrebergarten zu seinem Namen kam, was einen Kleingarten ausmacht und was zukünftige Pächter bei Erwerb und Unterhaltung beachten müssen.
Inhalte
- 1 » Wie der Schrebergarten zu seinem Namen kam
- 2 » Ein Blick in die Geschichte des Schrebergartens
- 3 » Die Bedeutung des Schrebergartens heute
- 4 » Einen Schrebergarten pachten, was ist zu beachten?
- 5 » Was kosten Schrebergärten?
- 6 » Darf man im Schrebergarten wohnen?
- 7 » Tiere im Schrebergarten – erlaubt oder nicht?
» Wie der Schrebergarten zu seinem Namen kam

Der Kleingarten wird nicht grundlos auch Schrebergarten genannt. Dies ist auf Daniel Gottlob Moritz Schreber zurückzuführen. Ob es sich bei dem im Jahre 1808 in Leipzig zur Welt gekommenen Arzt und Pädagogen um einen Pflanzenfreund handelte, ist nicht bekannt.
Selbst hat Schreber vermutlich kein Land bewirtschaftet. Sein Interesse galt körperlich und gesundheitlich benachteiligten Kindern und deren sportlicher Integration. Die Gründung des ersten Schrebervereins hat dessen Namensgeber selbst nicht mehr miterleben dürfen.
Es handelte sich auch bislang nicht um den typischen Kleingartenverein, sondern um einen Schul- und Erziehungsverein. Auf dem ersten Schreberplatz tummelten sich Mitte des 19. Jahrhunderts die Kinder. Um die Aktivitäten zu erweitern, wurde wenig später der gärtnerische Aspekt einbezogen. Familien fanden sich zusammen und bestellten die Beete. Diese wurden in Parzellen unterteilt und die ersten Schrebergärten waren entstanden.
» Ein Blick in die Geschichte des Schrebergartens
Die Entwicklung des Schrebergartens besaß auch einen historischen und gesellschaftspolitischen Hintergrund. Die Bevölkerung wuchs in den Anfängen des 19. Jahrhunderts. Gleichzeitig nahm die Armut zu.
Von wohlhabenden Bürgern wurden sogenannte Armengärten angelegt. Dort sollten die Menschen ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen, weniger Hunger leiden und ihre Arbeitskraft erhalten. Dieser praktische und nicht ganz uneigennützige Gedanke führte zur vermehrten Anlage von Kleingärten. Noch heute werden viele gern zum Selbstversorger und schätzen den Anbau von eigenem Obst und Gemüse aus ökologischer Sicht.
» Die Bedeutung des Schrebergartens heute
In den Großstädten fehlt es an Grünflächen. Wer keinen eigenen Garten am Haus unterhält, sehnt sich nach Erholung im Grünen und dem Anbau von Zier- und Nutzpflanzen. Den Menschen soll mit Kleingärten der Zugang zur Natur erhalten bleiben. Besonders für Familien mit Kindern besitzen Kleingärten einen hohen Erholungswert.
Die Erholung ist nicht der alleinige Eckpfeiler eines Schrebergartens in der heutigen Zeit. Im Vordergrund steht auch die kleingärtnerische Nutzung. Welche Pflanzen und Gehölze im Kleingarten angebaut werden dürfen, regelt die Kleingartenverordnung.
Rechtliches zum Schrebergarten

Schrebergärten werden nicht verkauft wie ein Haus oder ein Fahrzeug. Die Kleingärten werden verpachtet. Wer einen Garten pachten will, muss Mitglied des jeweiligen Kleingartenvereins werden. Entsprechend den Vorgaben in der Gartenordnung kann das Areal genutzt, bepflanzt und bebaut werden.
Tipp: Als überregionales Organ greift das Bundeskleingartengesetz.
So ist es etwa üblich, dass sich Gartenbesitzer zwischen einem Geräteschuppen oder einem Gartenhaus entscheiden müssen. Es gibt weiterhin gewisse Vorgaben, was die Übernachtung, das Halten von Tieren oder die Ausrichtung von Festen betrifft. Die Pächter eines Kleingartens sind dabei auch an die städtischen Auflagen zur Mittags-, Nacht- und Feiertagsruhe gebunden.
Das Wir-Gefühl im Schrebergarten
In einer Schrebergartenanlage kommen viele Menschen auf engem Raum zusammen. Es entsteht eine kleine Gemeinschaft. Ein harmonisches Miteinander wird forciert. Das Vereinsleben wird durch Versammlungen und Feste aktiv gestaltet. Man tauscht sich gegenseitig aus und nimmt aktiv teil am Vereinsleben.
Inwieweit sich jemand in die Gemeinschaft einbringt und im Verein aktiv wird, ist nicht zuletzt eine Frage von Einstellung und Charakter. Ein Schrebergarten sollte seinen Nutzern vorrangig die gewünschte Ruhe und Rückzugsmöglichkeit bieten, damit der Erholungswert nicht zu kurz kommt.
» Einen Schrebergarten pachten, was ist zu beachten?
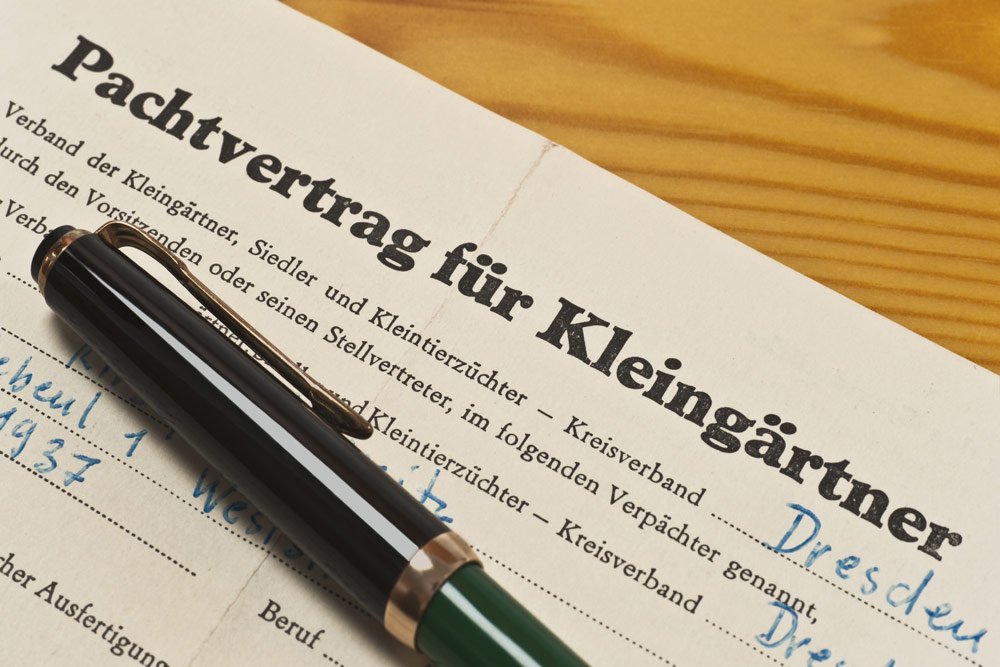
Wer sich mit dem Gedanken trägt, einen Schrebergarten zu pachten, sollte sich mit den Regeln und Vorgaben in der Parzelle vertraut machen.
Dazu zählen zusammengefasst folgende Punkte:
- Jeder Pächter muss Mitglied im Kleingartenverein werden.
- Schrebergärten dürfen nicht größer als 400 Quadratmeter sein.
- Das Gartenhaus darf nicht größer als 24 Quadratmeter sein.
- Der Schrebergarten muss zu mindestens einem Drittel für den Anbau von Obst und Gemüse genutzt werden.
- Der Anbau von Nutzpflanzen darf nur zum Eigenbedarf erfolgen.
In Großstädten sind Schrebergärten Mangelware. Wer Interesse hat, kann sich im jeweiligen Kleingartenverein vormerken lassen. Oft werden lange Listen geführt. Dabei erhalten häufig junge Familien oder Rentner den Zuschlag.
Der Mitgliedsantrag kann über die Homepage des Vereins oder während der örtlichen Sprechzeiten gestellt werden. Im Formular werden die persönlichen Daten, Alter, Anzahl der Kinder oder Beruf abgefragt. Wird ein Garten frei, erhalten meist mehrere Interessierte einen Termin für die Besichtigung. Der Vorstand trifft dann in einer seiner Sitzungen die finale Entscheidung.
» Was kosten Schrebergärten?
Zunächst ist die Ablösesumme relevant. Hierbei gibt es große Unterschiede. Die Kosten für das Gartenhaus und die angelegte Bepflanzung können, abhängig von Region und Zustand der Parzelle, im niedrigen dreistelligen wie auch im fünfstelligen Bereich liegen.
Nicht zu unterschätzen sind auch die laufenden Kosten für einen Schrebergarten. Die Pacht wird jährlich abkassiert. Auch hier sind die regionalen Unterschiede zu spüren.
Tipp: Die Pacht für einen Schrebergarten darf die vierfache Summe der Pacht für den erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau nicht übersteigen.
Durchschnittlich zahlen Kleingartenbesitzer jährlich zwischen 200 und 400 Euro für die Nutzung ihrer Parzelle. Weitere Kosten für die Unterhaltung eines Schrebergartens werden in folgender Übersicht genannt.
| Kosenstelle | Kosten pro Jahr | Besonderheiten |
|---|---|---|
| Vereinsbeitrag | 20 bis 100 Euro | • Zum jährlichen Vereinsbeitrag können noch Kosten für die Pflege der von den Gartenmitgliedern genutzten Anlagen kommen. |
| Wasser- und Stromkosten | 50 bis 100 Euro | • Die Wasserkosten werden häufig pauschal berechnet. • Da oft nicht jeder einen eigenen Zähler besitzt, werden die Forderungen unter den Pächtern geteilt. |
| Kosten für die Bepflanzung | ab 50 Euro | • Die Aufwendungen schwanken stark. • Ist bereits ein umfassender Bestand an Zierpflanzen vorhanden, beschränken sich die Kosten auf Samen und Setzlinge von Nutzpflanzen. |
| Kosten für Gartengeräte | 50 bis 400 Euro | • Vorhandene Gartengeräte müssen gelegentlich erneuert werden. • Die Neuanschaffung aller benötigten Gartengeräte ist kostenintensiv. |
» Darf man im Schrebergarten wohnen?
Viele Gartenbesitzer fragen sich: Darf man im Schrebergarten dauerhaft wohnen?
Die klare Antwort lautet: Nein. Ein Schrebergarten ist laut Bauplanungsrecht als Erholungsgebiet ausgewiesen und darf nicht als Hauptwohnsitz genutzt werden.
Schrebergarten übernachten – was ist erlaubt?
Wer im Sommer gelegentlich ein Wochenende im Garten verbringt oder im Gartenhaus übernachtet, verstößt nicht gegen die Regeln. Einmaliges oder sporadisches Übernachten im Schrebergarten ist erlaubt, solange die Nutzung erkennbar zur Erholung dient und nicht einem festen Wohnsitz gleichkommt.
Dauerhaft im Schrebergarten wohnen – was droht?
Wer seinen Schrebergarten als Hauptwohnsitz nutzt, riskiert ernste Konsequenzen:
- Kündigung des Pachtvertrags durch den Kleingartenverein
- Räumungsanordnung durch die Stadtverwaltung
- Mögliche Bußgelder, wenn baurechtliche Vorschriften missachtet werden
Besonders in Städten wird das dauerhafte Wohnen im Schrebergarten zunehmend kontrolliert. Gartenhäuser mit fest installierten Heizungen, Strom- und Wasseranschlüssen erwecken schnell Verdacht.
Gibt es Ausnahmen für das Wohnen im Schrebergarten?
In seltenen Fällen kann ein Schrebergarten als Wohnsitz geduldet werden, etwa bei nachgewiesenen Notlagen. Eine offizielle Genehmigung ist jedoch schwierig zu erhalten. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich direkt bei der Stadtverwaltung oder dem Vorstand erkundigen.
» Tiere im Schrebergarten – erlaubt oder nicht?
Beim Thema Tierhaltung offenbart das Bundeskleingartengesetz einige Lücken. Grundsätzlich steht die gärtnerische Nutzung der Parzelle im Mittelpunkt, aber unter bestimmten Bedingungen kann Tierhaltung erlaubt sein. Wer Tiere im Schrebergarten halten möchte, sollte sich vorab mit dem Vorstand abstimmen. Viele Vereine haben eigene Regeln, die in der Satzung oder Gartenordnung festgelegt sind.
Welche Tiere sind erlaubt?
Kleintiere wie Kaninchen oder Meerschweinchen sind in vielen Anlagen erlaubt, solange sie artgerecht gehalten und die Nachbarn nicht gestört werden. Hunde dürfen oft mitgebracht werden, müssen aber auf dem Gartengelände angeleint bleiben.
Auch Bienenhaltung im Schrebergarten kann möglich sein, wenn der Verein zustimmt. Dafür sind vorwiegend eine Genehmigung des Vorstands, das Einverständnis der direkten Nachbarn sowie eine Meldung beim Veterinäramt erforderlich.
Welche Tiere sind nicht erlaubt?
Nicht gestattet sind in der Regel Tiere, die für einen Kleingarten untypisch sind oder andere stören könnten. Dazu gehören:
❌ Nutztiere wie Ziegen, Schafe oder Schweine
❌ Lautstarke Tiere wie Gänse oder Hähne
❌ Gewerbliche Tierhaltung jeder Art
Besonderheit in den neuen Bundesländern
Eine Ausnahme gibt es für einige Gärten in den neuen Bundesländern. Wer schon vor der Wiedervereinigung Hühner hielt, darf dies unter bestimmten Bedingungen weiterhin tun (§ 20a Abs. 7 BKleingG).
Fazit
Wer Tiere im Schrebergarten halten möchte, sollte sich vorher informieren. Die meisten Vereine gestatten Kleintiere, solange sie sich in die Gartenanlage einfügen und keine Nachbarn stören. Rücksichtnahme ist das A und O!







